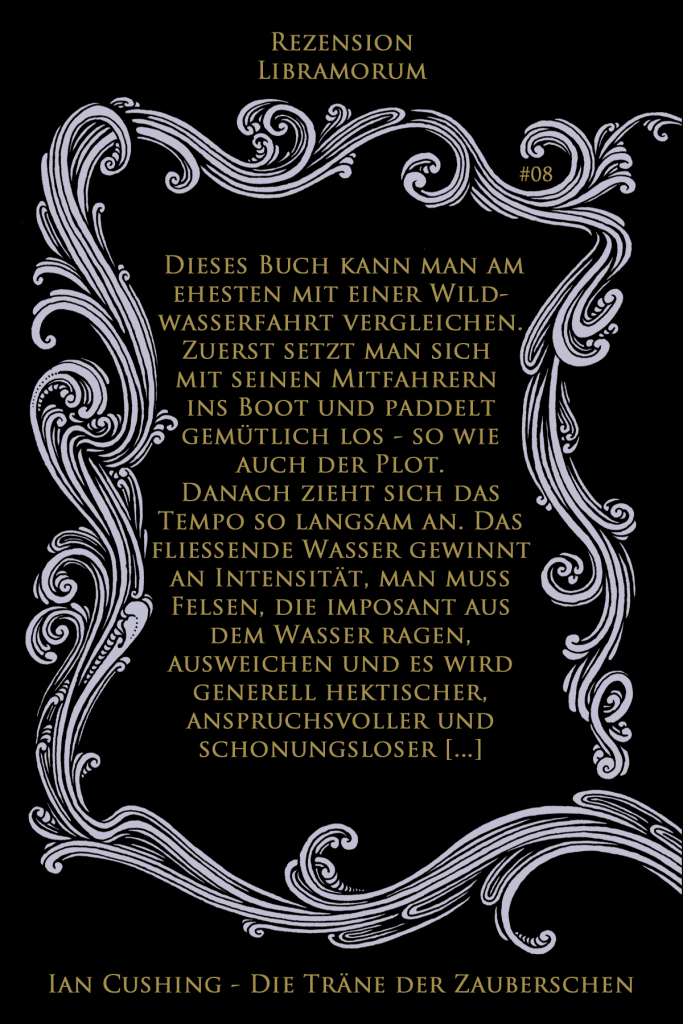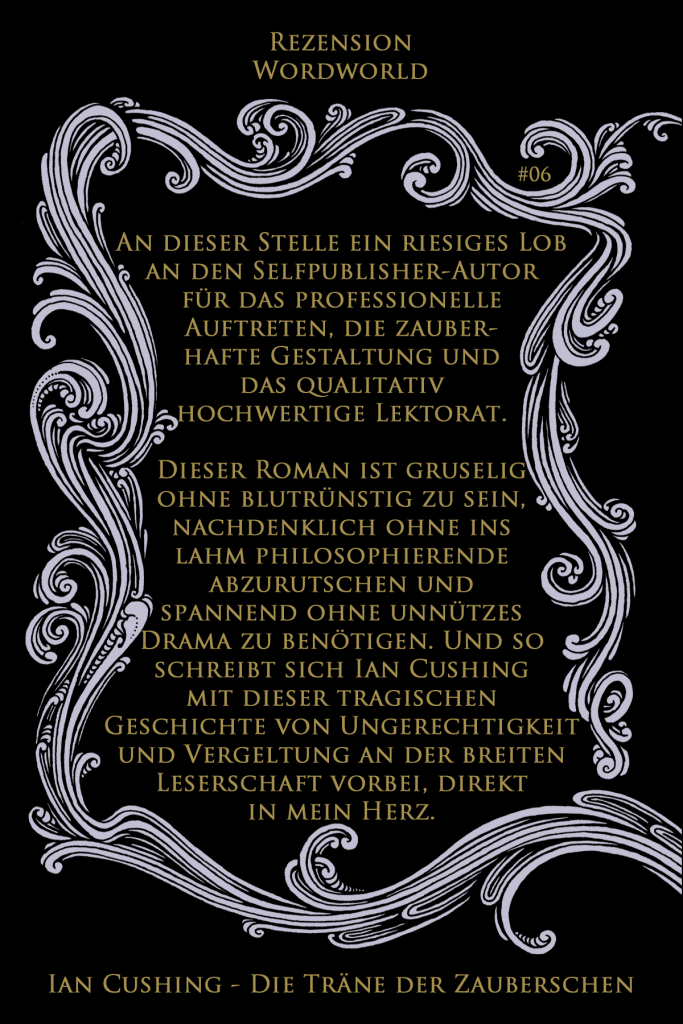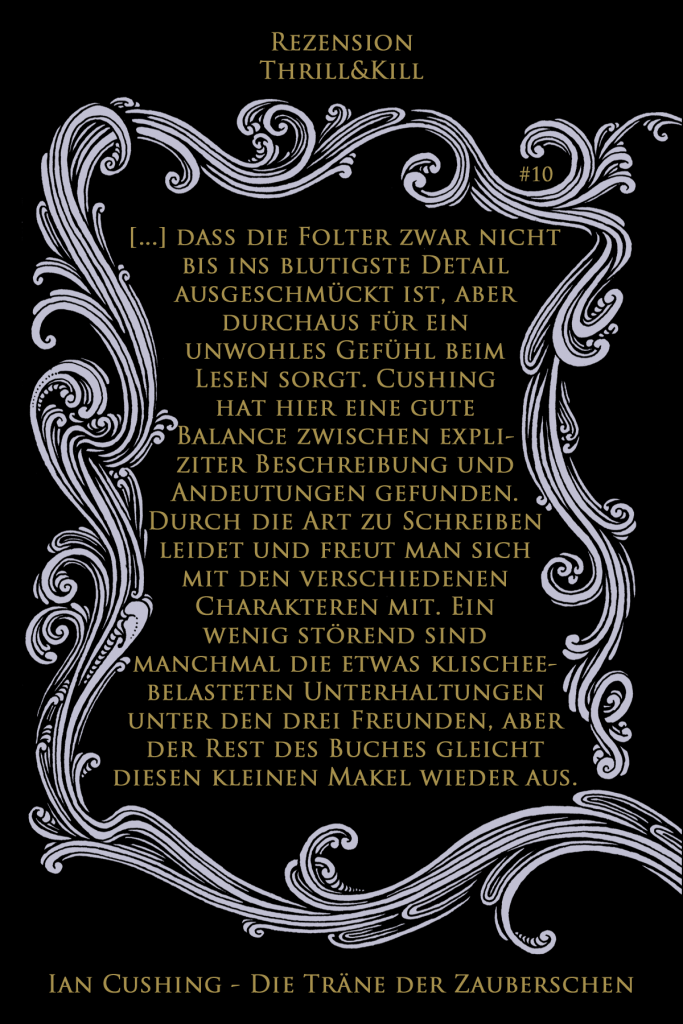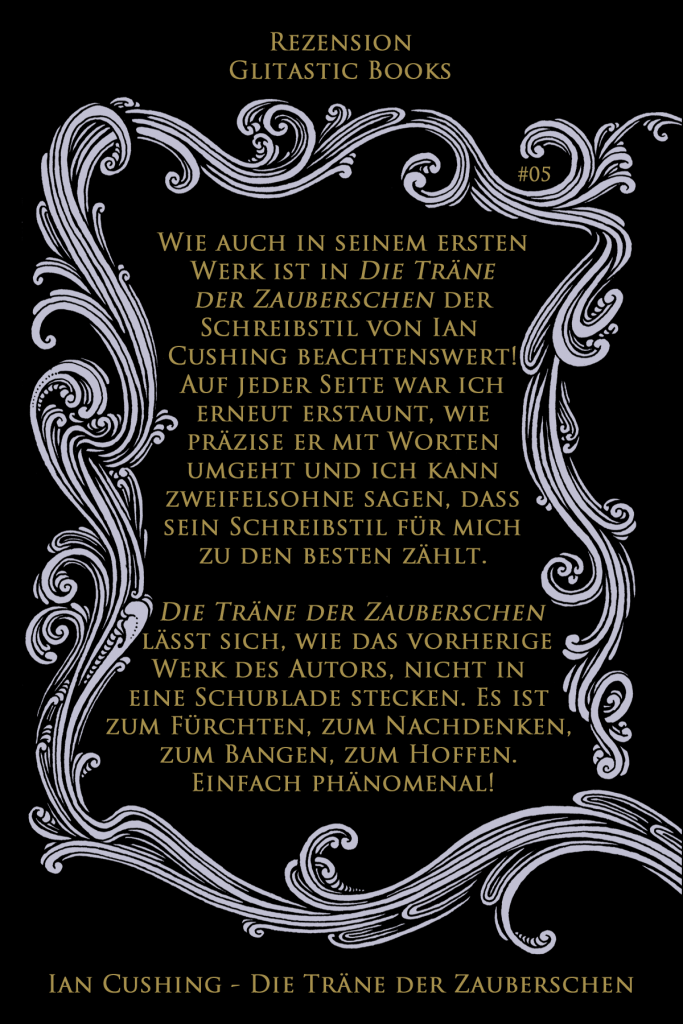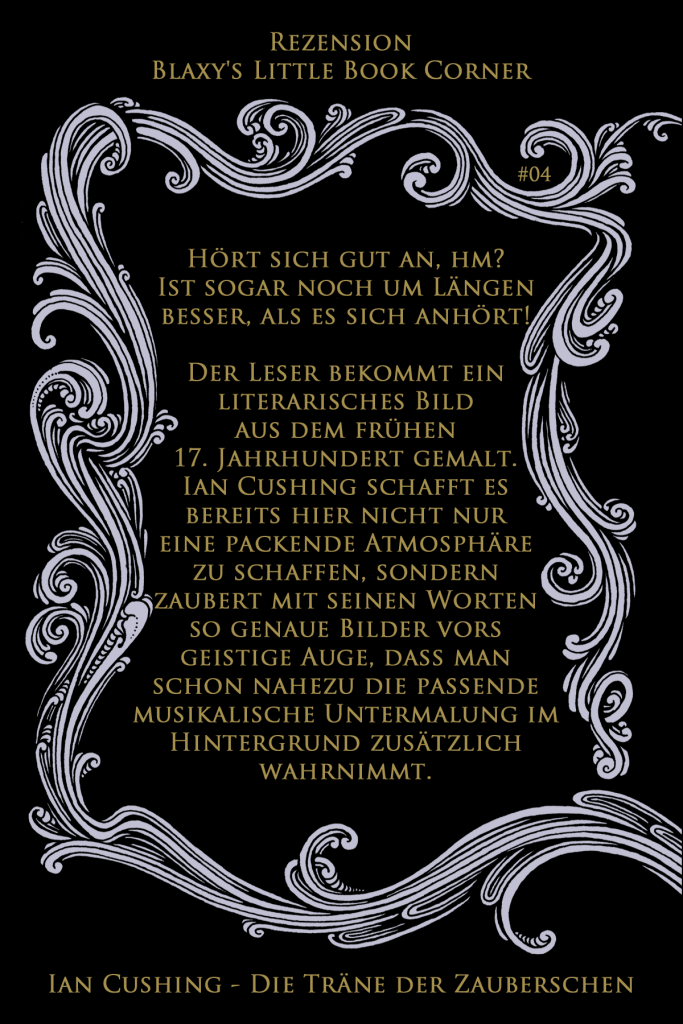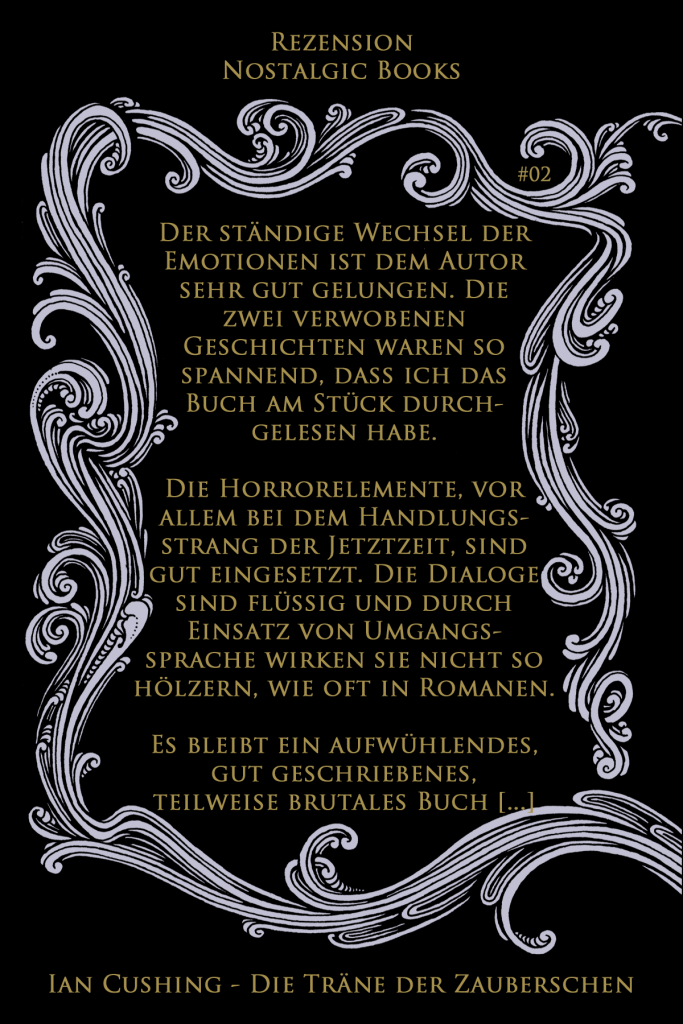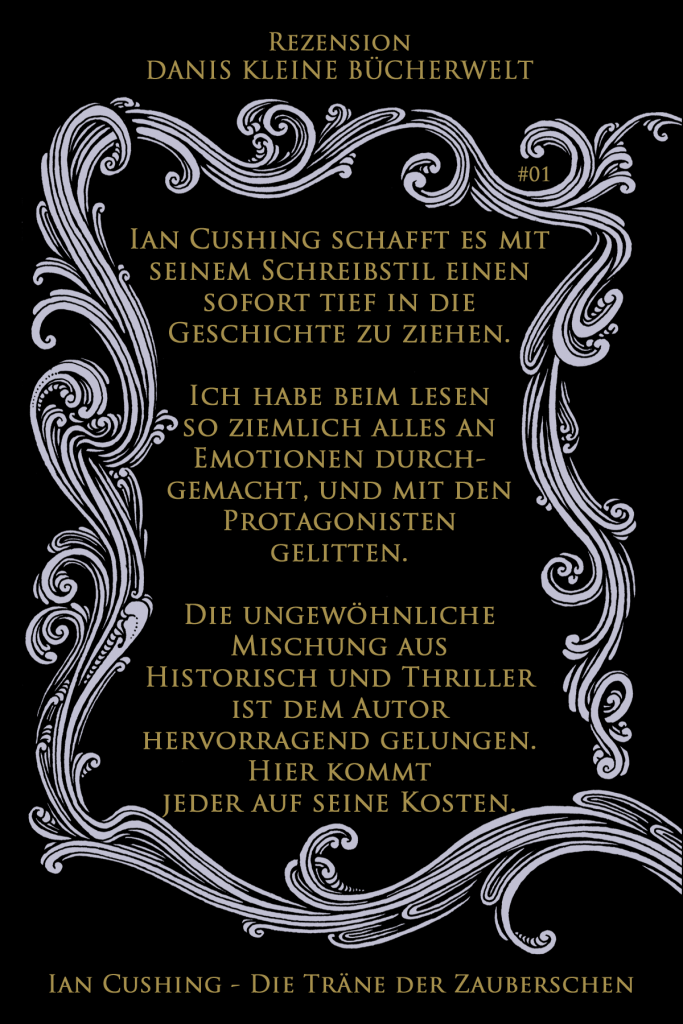Phantastische Fluchten – Facebook
Phantastische Fluchten – Homepage
Das Jahr 1611
Barbara und ihr Mann Friederich leben glücklich und zufrieden dem kleinen Dorf Pfüeln. Ihr Glück wird vollkommen, als ihre Tochter Greta geboren wird. Das Paar ist im Dorf allseits beliebt und ihre Tochter ist ein kleiner Sonnenschein Durch die Bäckerei haben die Eheleute ein kleines Auskommen und Barbara läuft ihrem Mann als Bäcker bald den Rang ab, da sich ihre Torten großer Beliebtheit erfreuen.
Die junge Frau ist in der Kräuterkunde ebenso bewandert wie im Backhandwerk und so steht sie vielen Bewohnern des Ortes oft hilfreich zur Seite und kuriert ihre Wehwechen. Der Friede des Ortes und das harmonische Zusammenleben der Bewohner werden jäh gestört, als Barbara plötzlich der Hexerei bezichtigt wird. Niemand glaubt diesen Anschuldigungen, ist Barbara doch für ihre Gläubigkeit bekannt.
Doch sind die Zweifel erst einmal gesät…
Das Jahr 2011
Marcus, Jan und Dirk sind seit ihrer Schulzeit die dicksten Freunde. Obwohl sie sehr unterschiedliche Charaktere sind und verschiedene Weltanschauungen haben, stört das ihre Freundschaft nicht. Alle drei jungen Männer lernen etwa zur gleichen Zeit ihre Traumfrau kennen, heiraten und werden Vater einer Tochter. Und auch drei Ehefrauen, sowie die drei Töchter freunden sich miteinander an. Das alles erscheint mehr als zufällig und bald stellen die drei Freunde fest, dass ein Ereignis aus der Vergangenheit sie alle miteinander verbindet.
Kommentar:
Es handelt sich hier um eines der schrecklichsten Bücher, welches ich in den letzten Jahre gelesen habe. Nicht schrecklich im Sinne von schlecht sondern schrecklich weil ich beim Lesen eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt habe. Das Buch hat mich emotional sehr berührt und ich habe die Ereignisse förmlich miterlebt und mit erlitten. Wenn ein Autor es schafft, den Leser so in seine Geschichte hineinzuziehen, dann hat er alles richtig gemacht.
Die Erzählung beginnt völlig harmlos. Wir erleben mit, wie Barbara ihrem Friederich das erste Mal begegnet, zwei Menschen, die füreinander geschaffen sind. Dieses Glück strahlt auch auf die Nachbarschaft über, ihre warmherzigen und hilfsbereiten Wesen machen sie im ganzen Ort beliebt. Während des Backens singt Barbara die Lieder, die sie in der Kirche gehört hat und ihre glockenklare Stimme erfreut das ganze Dorf. Greta kommt ganz nach ihrer Mutter. Sie ist ein liebenswertes und sehr wissbegieriges Kind. Schon im Alter von sechs Jahren kann sie verschiedene Kräuter auseinanderhalten und kennt deren Wirkung. Oft begleitet sie ihre Mutter, wenn diese den Dorfbewohner heilende Tränke bringt. Das Leben ist Pfüeln ist nicht einfach aber der Vogt des Ortes sorgt für seine Menschen und schaut, dass niemand ungerecht behandelt wird. Sowohl der Pfarrer als auch der Vogt hegen große Zuneigung zu der jungen Frau und ihrer hübschen Tochter, es scheint unvorstellbar, dass diese dörfliche Idylle jemals getrübt wird. Doch Neid und Missgunst finden sich überall und so wird Barbara der Hexerei bezichtigt.
Ian Cushing strebt langsam aber zielstrebig dem Höhepunkt entgegen. Wie Barbara selbst, glaubt auch der Leser nicht an eine echte Gefahr. Wir, mit dem Verstand und diesem Wissen des 21. Jahrhunderts können uns einfach nicht vorstellen, dass man den haltlosen Anschuldigen Glauben schenkt. Aber auch heute kommt es durchaus zu Rufmord und wenn man die teilweise sehr gehässigen Posts im Internet liest, hat sich seit dem 17. Jahrhundert nicht viel verändert. Der Mensch bleibt sich selbst sein ärgster Feind. Zu Barbaras Leidwesen weilt gerade der Bannrichter Justus Arbiter beim Vogt zu Gast, ein selbstgerechter und anmaßender Mensch, der keinerlei Gnade kennt.
Wenn man diese Passagen liest, bekommt man einen regelrechten Hass auf diesen Mann. Er ist das wandelnde Klischee eines Hexenverfolgers und lässt keine Argumente gelten, die zu Barbaras Gunsten sprechen. Hier schwanken die Emotionen des Lesers zwischen Hass, Wut und Trauer, man fühlt sich, ebenso wie Barbara und der Vogt, absolut hilflos gegenüber solcher Ignoranz und Willkür. Dieses Mannes.
Die Geschichte pendelt zwischen den zwei Epochen hin und her. Immer wenn man meint, es nicht länger zu ertragen, erfolgt ein Bruch und man befindet sich im Jahr 2011. Auch hier beginnt alles ganz harmlos. Die drei Paare sitzen beim ihrem Lieblingsgriechen und feiern ihr Wiedersehen. Dirk war mit seiner Frau Manuela aus beruflichen Gründen nach Weimar gezogen. Als Manuela bei der Geburt ihrer Tochter Lilly starb, kehrte Dirk zurück nach Pfuhlenbeck und die drei Musketiere sind endlich wieder vereint. Es fügt sich gut, dass ihre Töchter in die gleiche Schule gehen und auch die Ehefrauen relativ gut miteinander auskommen. Zwar hinterlässt der Tod von Manuela eine Lücke aber Dirk konzentriert sich ganz auf seine Tochter und scheint relativ glücklich. Alles wirkt sehr lebendig, menschlich und überzeugend. Eine Alltagsszene, wie man sie besser kaum beschreiben kann.
Marcus ist der erste der drei Freunde, der ungewöhnlichen und bedrohlichen Besuch erhält. Natürlich erzählt er seinen Freunden von dieser Begegnung, auch wenn sie bei Tageslicht eher wie ein Alptraum erscheint. Dirk merkt sofort, dass Jan ihnen etwas verheimlicht, die Geschichte von Marcus scheint bei Jan etwas auszulösen, doch er schweigt.
Ab da wird der Leser ebenfalls mit unendlichem Leid, Trauer, Wut, Hilflosigkeit, Ungerechtigkeit und Schmerz konfrontiert. Der Autor verschont weder seine Charaktere noch seine Leser und er geht konsequent seinen Weg. Kein Mitleid, kein Einknicken in letzter Sekunde, kein Erbarmen. Ich war teilweise fassungslos wie grausam Ian Cushing mit seinen Figuren umgeht. Manchmal wusste ich nicht, ob ich ihn nicht mehr hasse als die Figuren in seinem Buch. Denn letztendlich hat er sich diese Geschichte ausgedacht und stürzt mich somit in eine emotionale Krise.
Was für eine großartige Geschichte. Einfach aber beeindruckend. Sprachlich bewegt sich der Autor auf sehr hohem Niveau. Was mir besonders gut gefallen hat ist die sprachliche Abgrenzung der Jahrhunderte. Die Sprache des 17. Jahrhunderts unterscheidet sich doch sehr von unserer Sprache und der Autor hat es geschafft, diese Unterschiede das ganze Buch über aufrecht zu erhalten, ohne jeden Fehler. Somit sind beiden Teile nicht nur zeitlich sondern auch sprachlich abgegrenzt.
Über das Cover wurde schon viel diskutiert. Der Titel ist wirklich schwierig zu lesen aber dafür steht er ja auf der Seite. Jede andere Schriftart hätte die Harmonie des Gesamtbilds gestört. Wenn man die ersten Seiten gelesen hat, sieht man das Bild noch einmal mit ganz anderen Augen, es wirkt eindringlicher und bedrohlicher. Die Farben schwarz und Gold passen ausgezeichnet zueinander und geben einen schönen Kontrast.
Fazit:
Für mich ist „Die Tränen der Zauberschen“ ein Highlight des Jahres 2019. Und ich habe dieses Jahr wirklich schon einige wunderbare Geschichten aus der Feder von Selfpublishern gelesen. Also traut euch, auch abseits des Mainstream zuzugreifen.