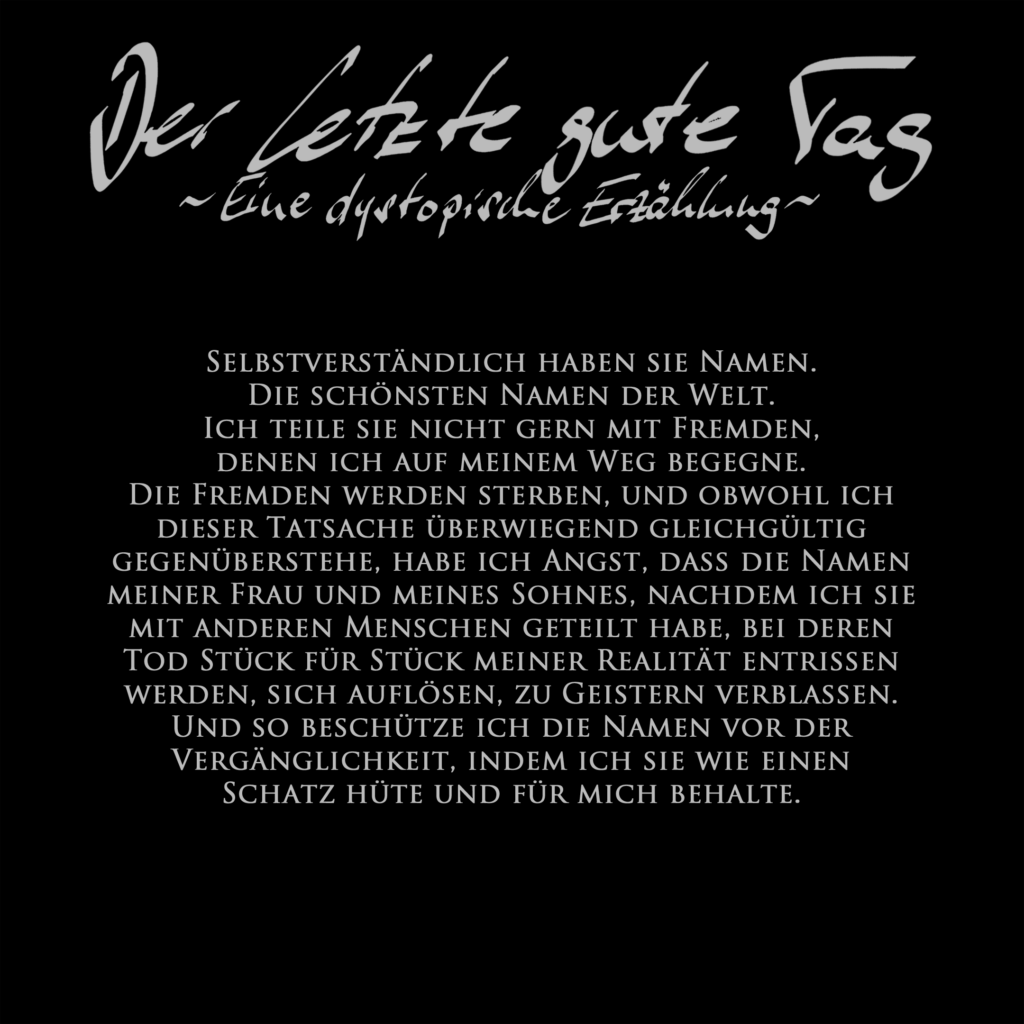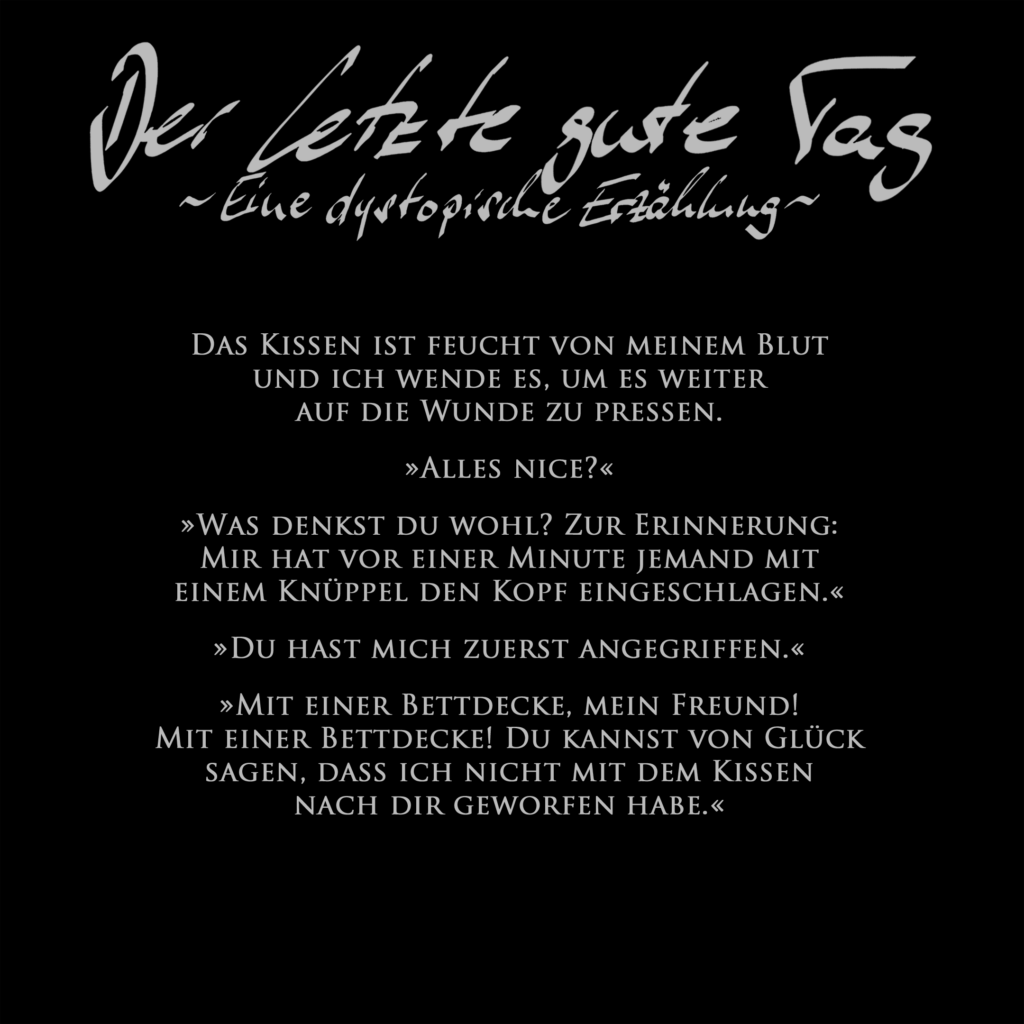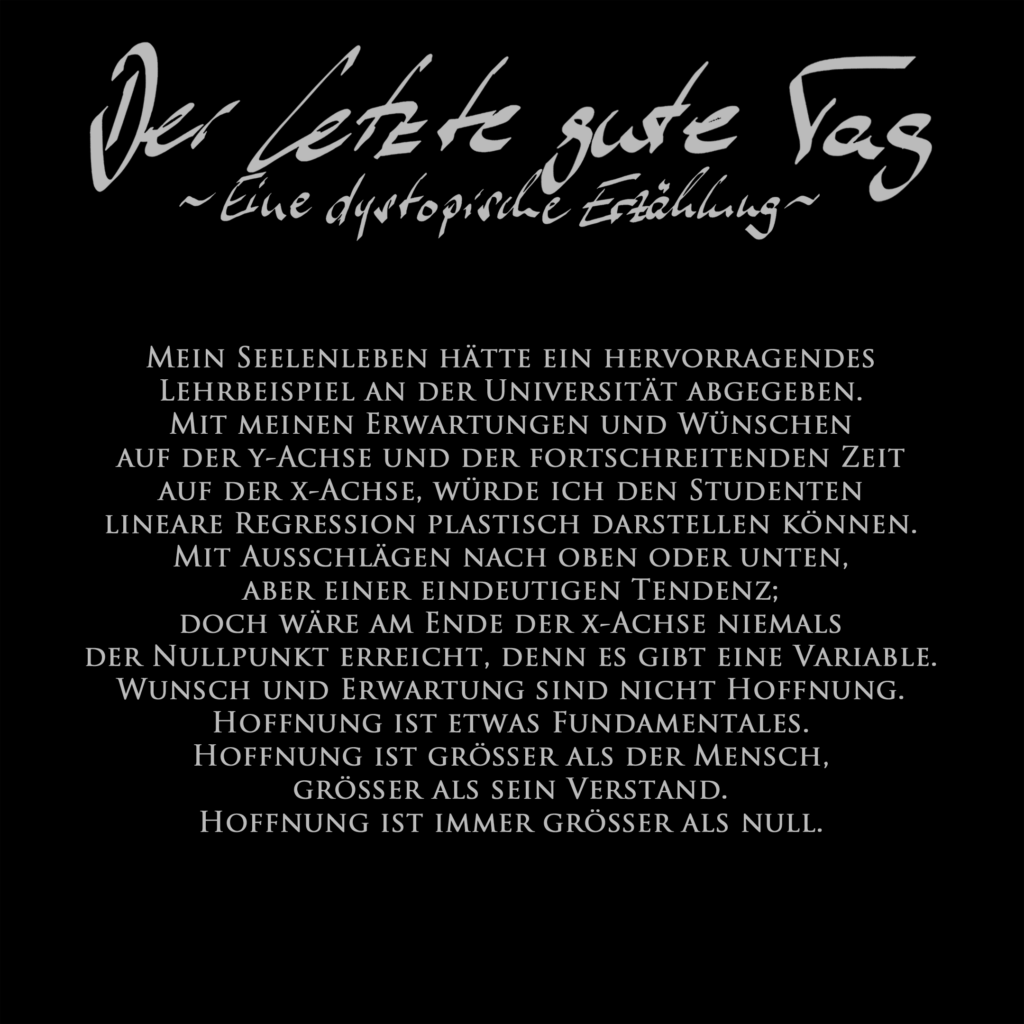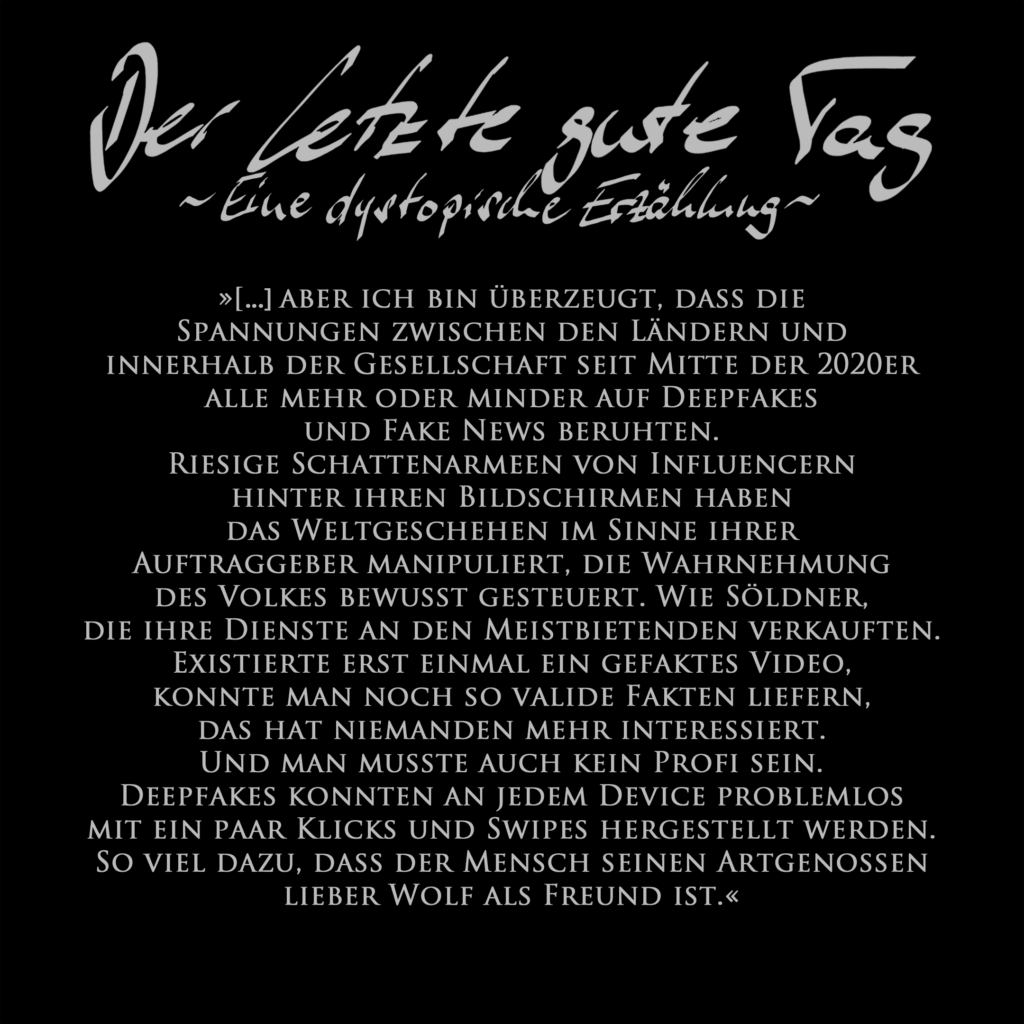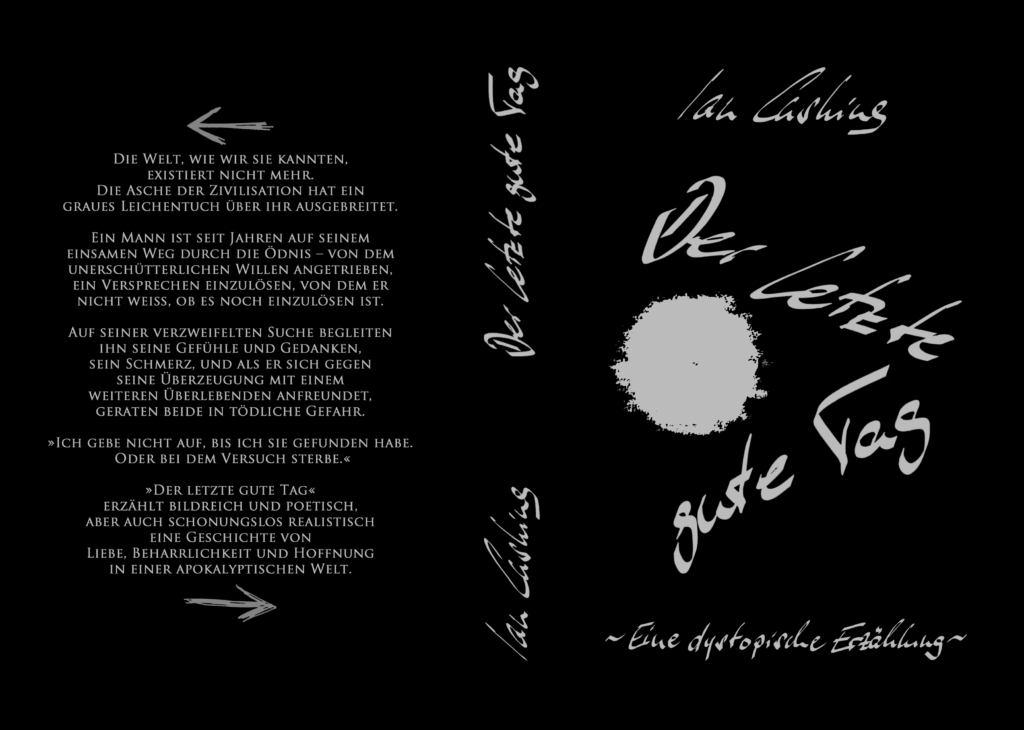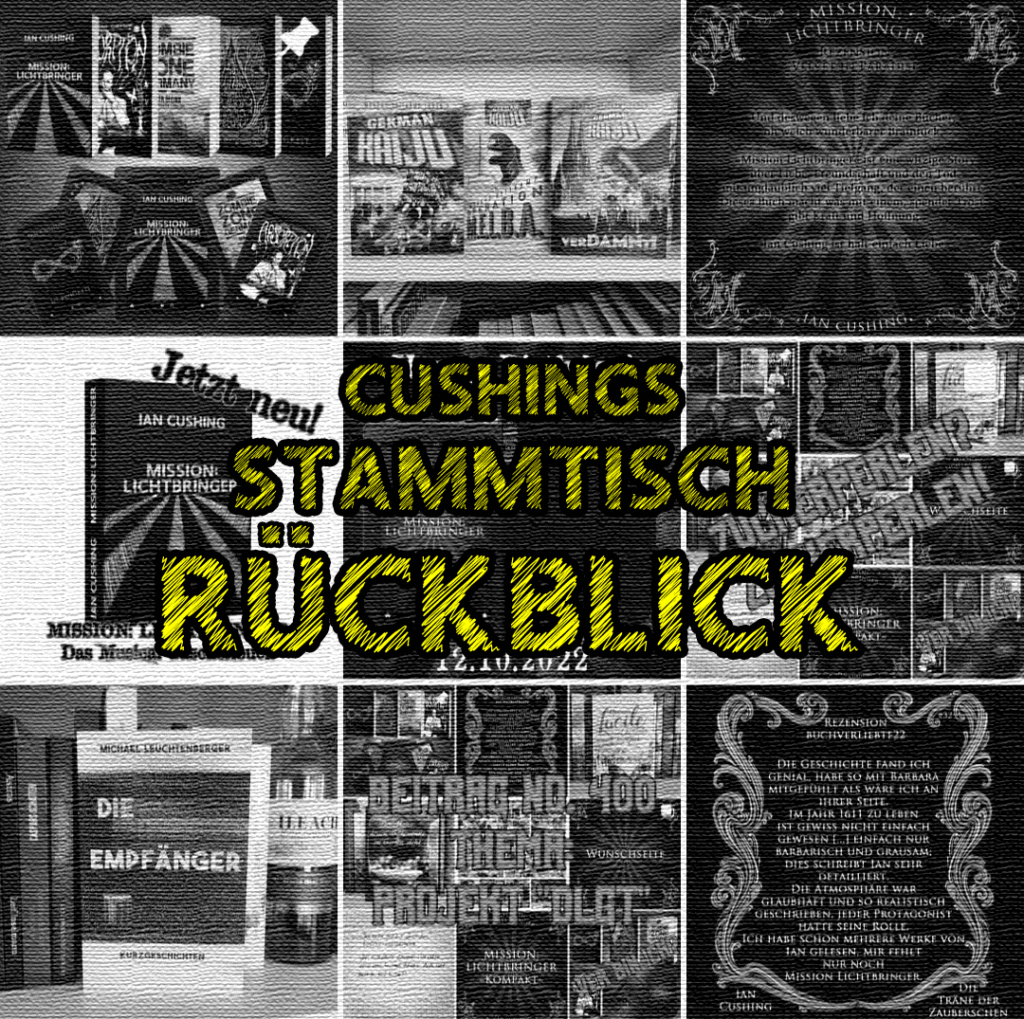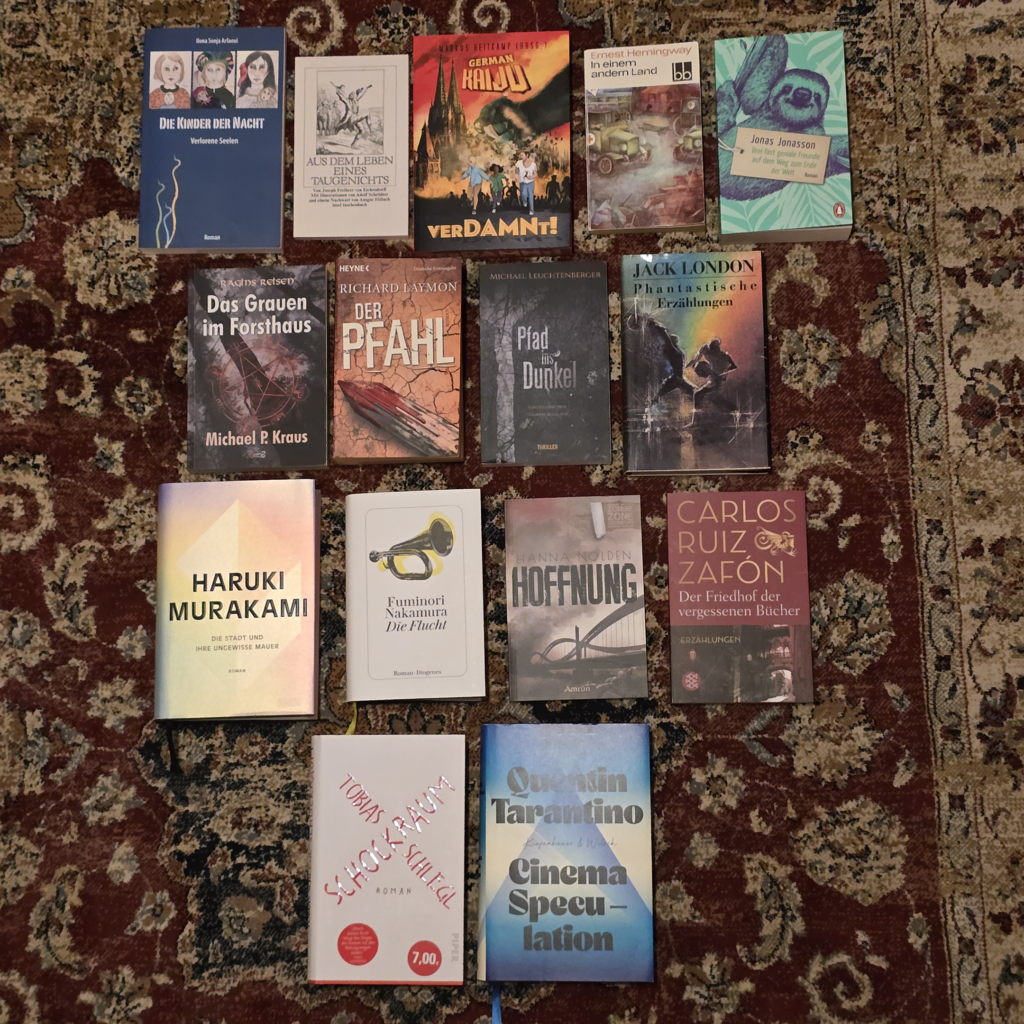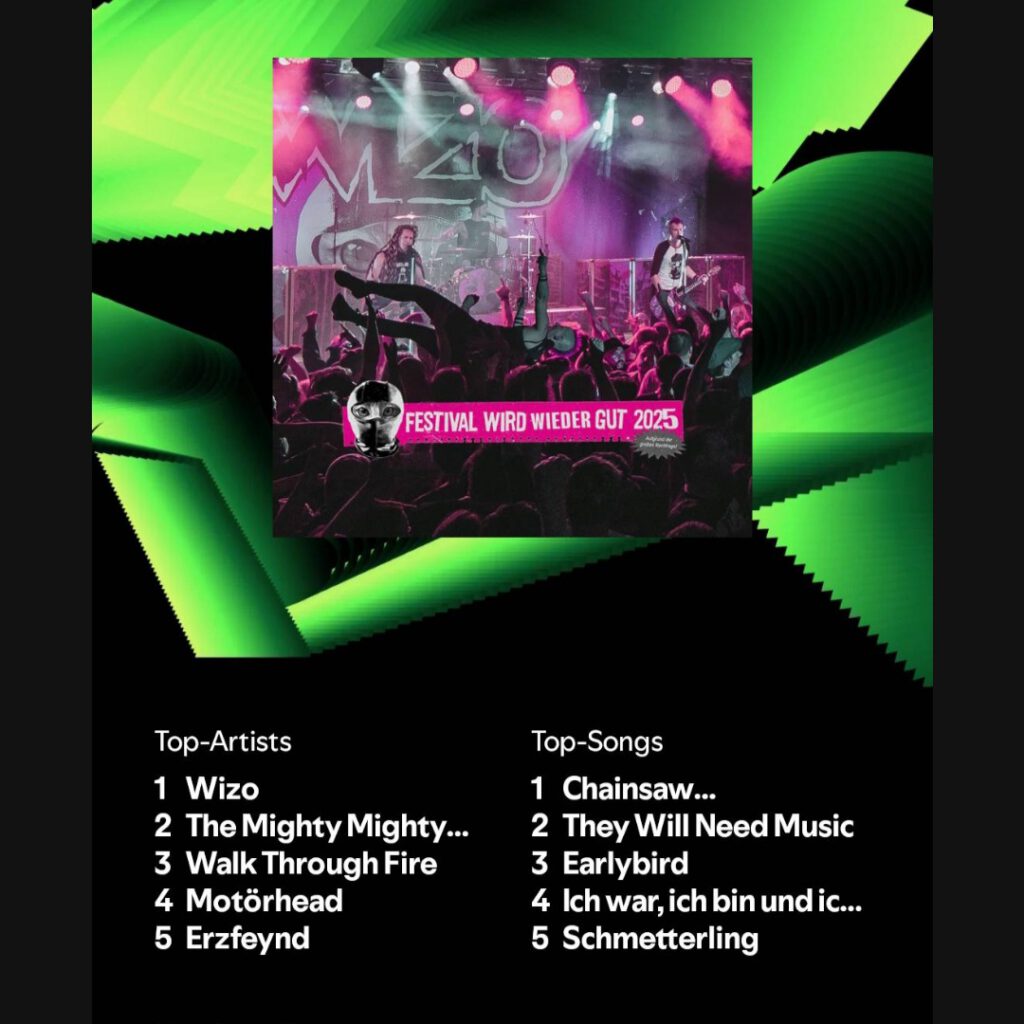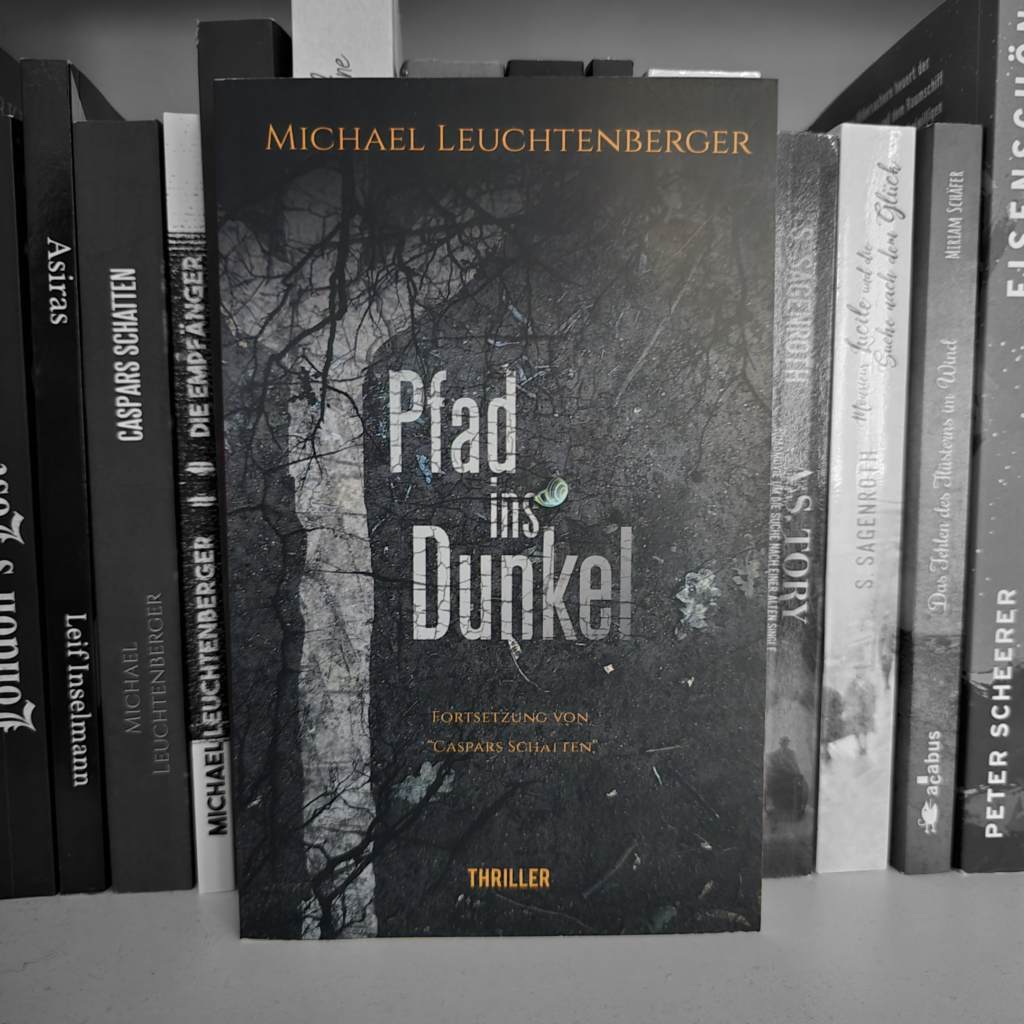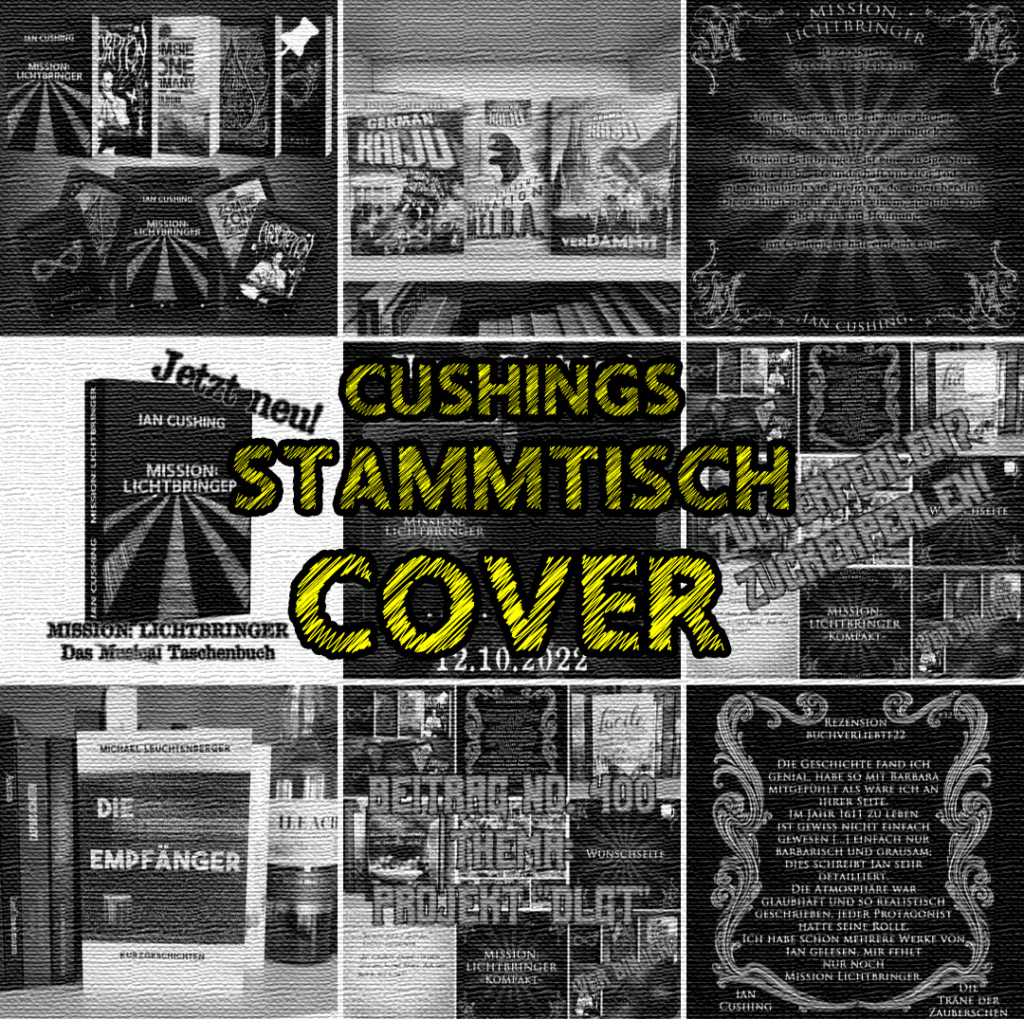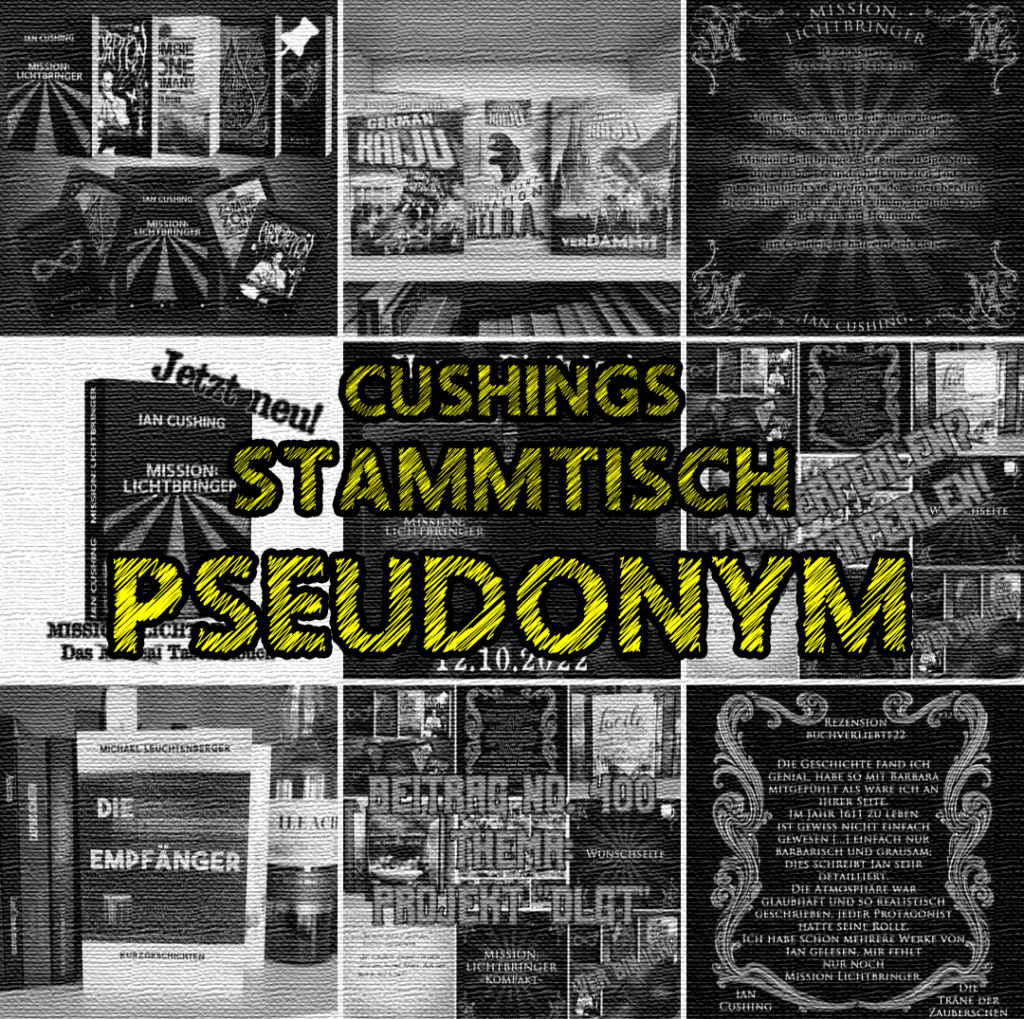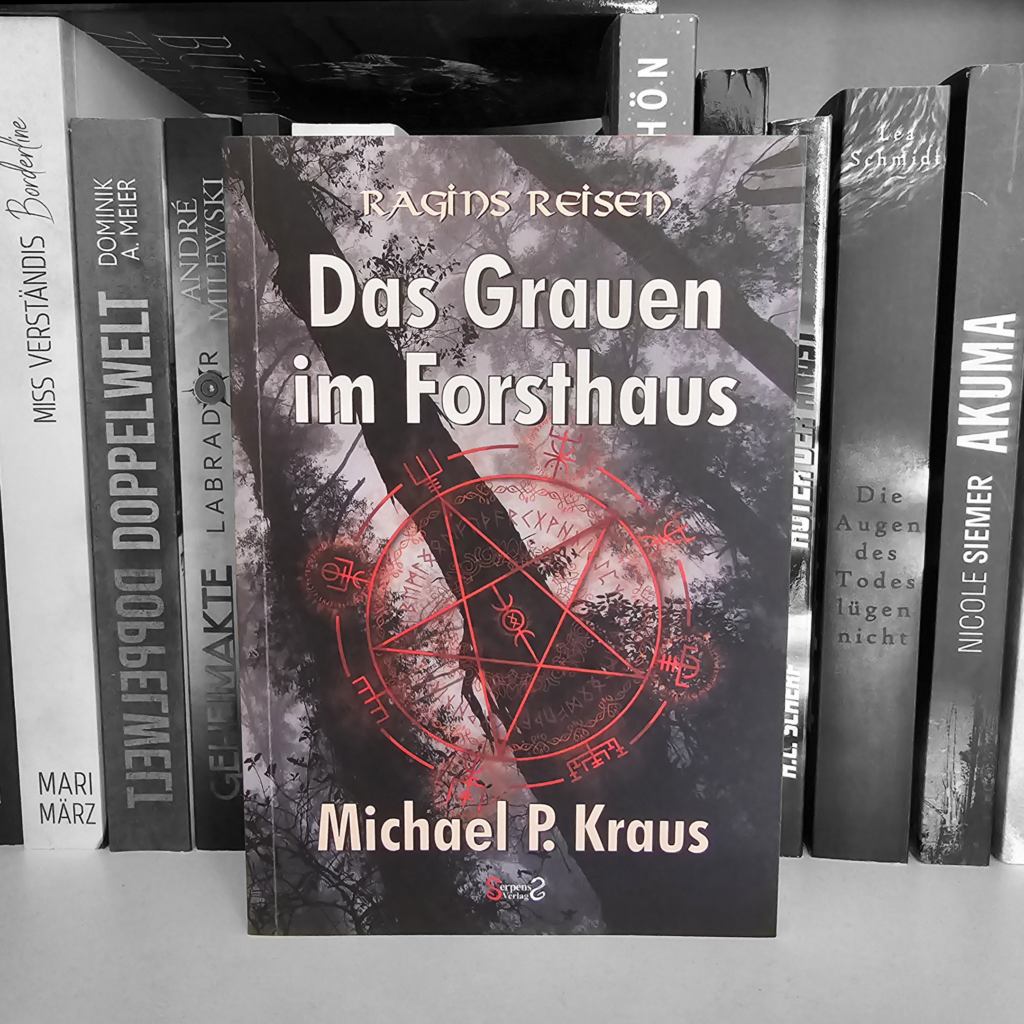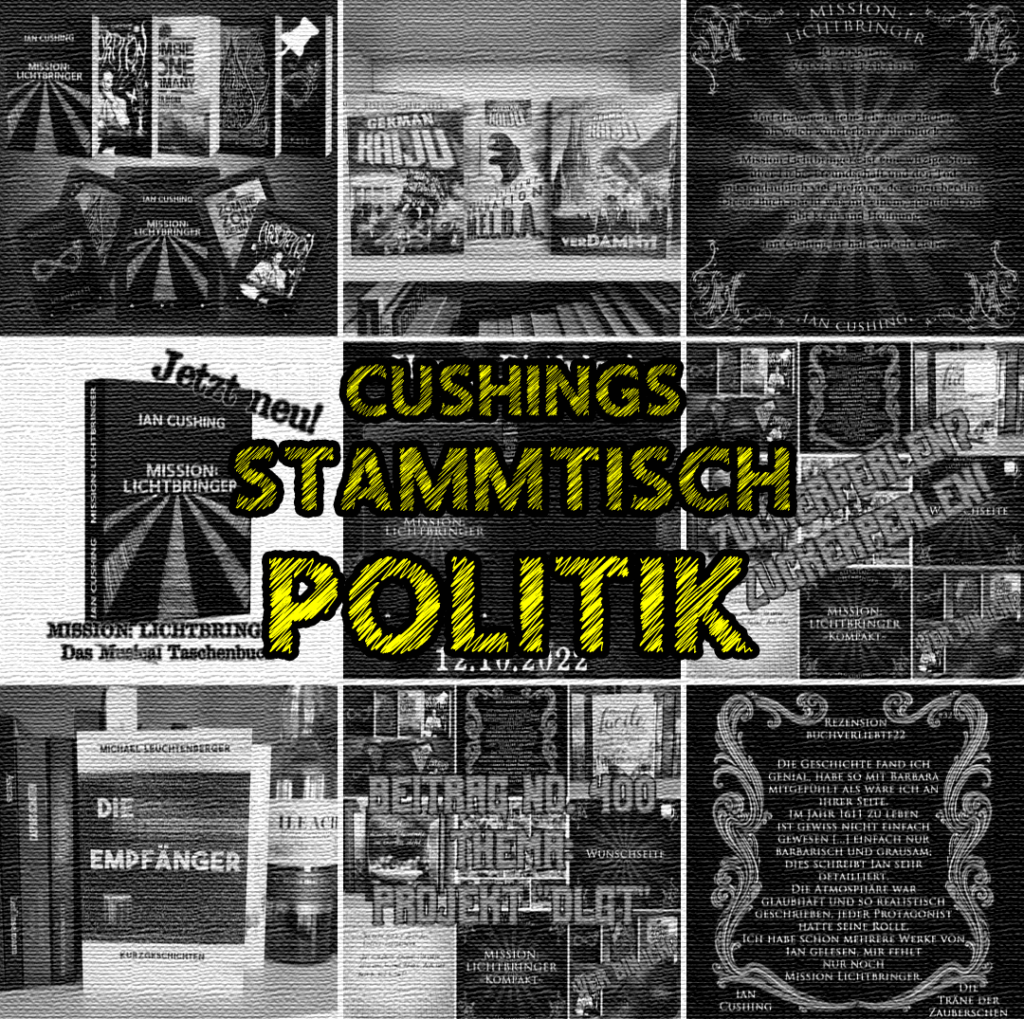
Liebe Zuckerperlen und Lichtbringer,
was wäre ein guter Stammtisch ohne das leidige Thema Politik? Ein friedlicher, vermutlich.
In knapp einem Monat ist Bundestagswahl. Warum? Weil die Politiker den Herrn der Ringe nicht gelesen – oder zumindest nicht verstanden – haben.
Wenn Sauron seine hässliche Fratze erhebt, seine debilen – aber agilen – Horden durchs Land und das Internet marodieren, der Schönheit des Auenlandes und Vielfältigkeit des Lebens den Kampf ansagen, müssen sich Elben, Zwerge, Hobbits und Menschen nun einmal zusammenreißen und an einem Strang ziehen. Genau das hat unsere aktuelle Regierung in meinen Augen versäumt. Anstatt gemeinsam zu arbeiten, haben sie sich unentwegt Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und das ist etwas, was ich ihnen etwas übelnehme. Es gibt schließlich eine Bedrohung, die größer ist, als das Ego des Einzelnen.
Die stärkste Waffe der blau-braunen Orks ist das Internet. Die Möglichkeiten, Hass und Zwietracht zu säen, Fake News und konservativ-nationalistische Hetze zu betreiben, sind schier unerschöpflich. Und es ist grausam anzusehen, wie ein großer Teil der Menschen bereitwillig dafür sorgt, dieses Klima des Hasses und der Ausgrenzung nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch immer mehr in der realen Welt zu verbreiten.
Aber wir sind klüger, oder? Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.
WIR sind die Gefährten, die der blonden Saurine und ihren Horden den Ring verweigern.
WIR sind Dumbledores Armee, die für Werte eintritt, die die Todesser abgeschafft sehen wollen, weil sie selbst kein Herz haben.
WIR sind die Winston Smiths, die gegen die große Schwester rebellieren.
WIR sind die Guy Montags, die gegen die selbstgewählte Verdummung der Bevölkerung anschreiben.
Und DIE sind garantiert nicht Pippi Langstrumpf. Sie werden sich ihre Welt nicht machen, widdewidde wie sie ihnen gefällt. Weil wir mehr sind. Weil wir laut sind. Weil wir Menschen sind.
Fallt nicht auf die Rattenfänger rein. Sie spielen lediglich die Klaviatur der Emotionen hoch und runter, aber auch sie werden keine Lösung für die vielfältigen Probleme haben. Das wird spätestens dann deutlich, wenn sie irgendwann mitregieren. Und auf ewig wird sich das nicht verhindern lassen. Im besten Falle wäre das auch ein Schritt dahin, dass die sogenannten Protestwähler erkennen, dass oppositionelles Sprücheklopfen und provokante Hetze (ohne selbst in der Verantwortung zu stehen) eben doch nur heiße Luft sind und man auch nur mit Wasser kocht. Dennoch fühlt es sich so an, als würde man Dracula freiwillig in sein Schlafzimmer hineinbitten. Kommen nie was Gutes bei rum. War schon 1933 so und wird vermutlich auch diesmal den Grundstein für ungewollte und inakzeptable gesellschaftliche Veränderungen legen.
Doch vorerst werden viele einer Partei folgen, die vom Verfassungsschutz als ein rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wurde. Und in zehn Jahren werden WIR und DIE nicht sagen können: »Davon haben wir nichts gewusst.« Wir schauen alle bereits zu. In der Straßenbahn, in den Nachrichten, im Internet.
Mit der Politik muss niemand grundsätzlich einverstanden sein. Bin ich ja auch nicht immer. Politik ist komplex. Vermutlich so komplex, dass die Meisten von uns (mich inkludiert), nicht alles erfassen können, was hinter allen möglich Entscheidungen für diplomatische Kompromisse stecken. Da ist Vertrauen der Schlüssel.
Doch aufgrund einer gefühlten – und von bestimmten politischen Parteien geschürte – Unzufriedenheit die Menschlichkeit und Vernunft, den Anstand und Respekt deswegen über Bord zu werfen … das ist eine Grenzüberschreitung, die wir niemals tolerieren dürfen.
Seid vernünftig. Geht wählen. Verhindert Faschismus, Hetze und Vertreibung.
In diesem Sinne … Nie wieder Nazis an die Macht!
Ian.
#iancushing #selfpublisher #antifaschist #lapennadelpartigiano #inewigkeit #dietränederzauberschen #absorption #missionlichtbringer